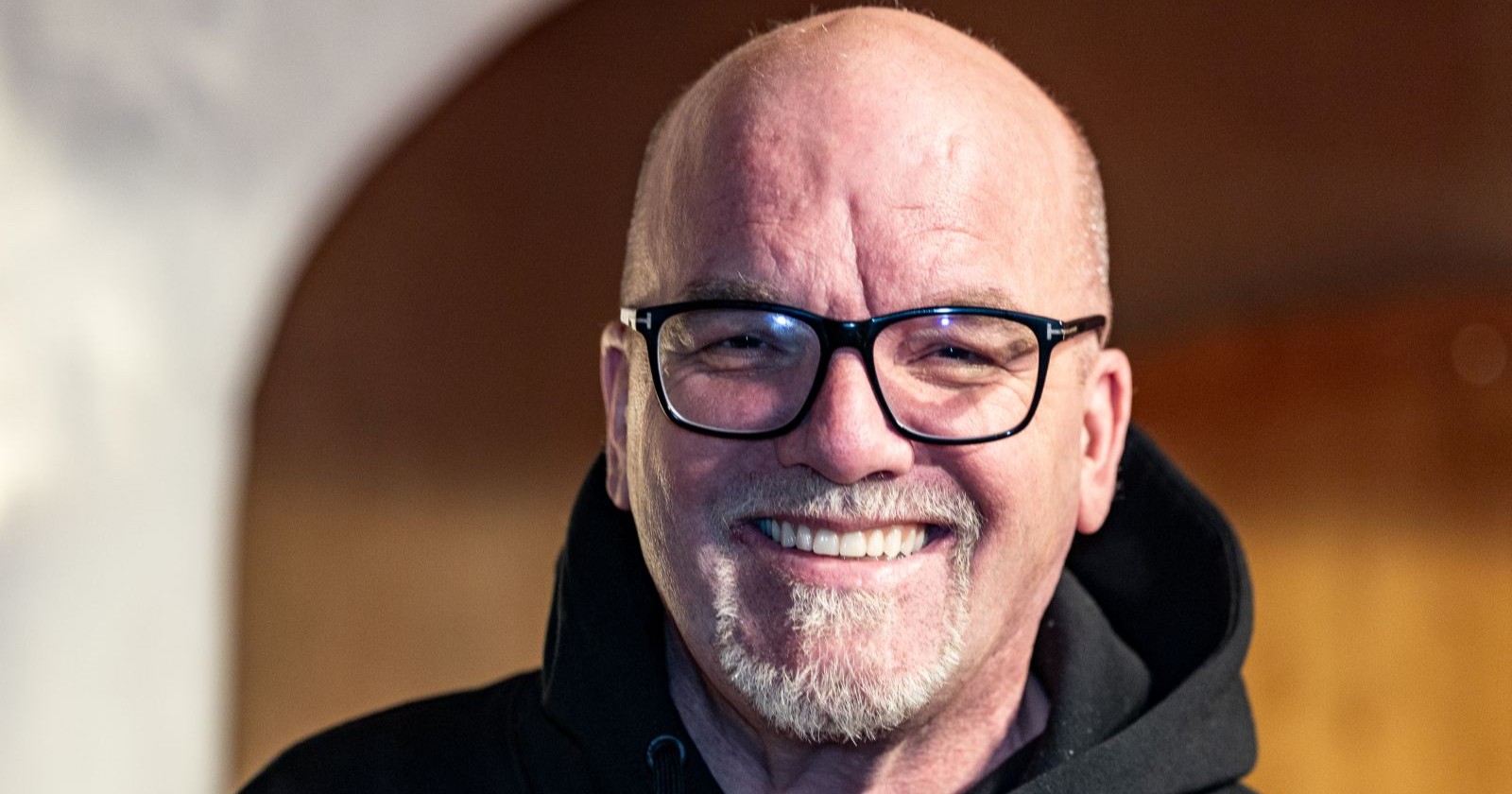Quo vadis, Zeitung?
CHEFINFO: Was ist charakteristisch für die österreichische Medienlandschaft?
Josef Trappel: Die österreichische Medienlandschaft zeichnet sich durch einen hohen Grad an Eigentümerkonzentration aus. Wir haben wenige, aber dafür relativ große Medienhäuser und einen sehr erfolgreichen öffentlichen Rundfunk. Was wir in Österreich aber auch sehen, ist ein hoher Grad an Boulevardisierung. Im internationalen Vergleich haben wir eine sehr starke Boulevardpresse, die, obwohl sie Federn lassen musste, immer noch sehr wirkungsmächtig ist. Und an dieser Konstellation von Eigentümerkonzentration und Boulevard hat sich in den vergangenen 20 Jahren wenig verändert, trotz Digitalisierung und Medienumbruchs. Das ist ein ziemlich stabiles Setting.
Dabei gibt es eigentlich eine Medienförderung, die ja Qualitätsmedien gegenüber dem Boulevard stärken und die Vielfalt erhalten soll, oder?
Trappel: Ursprünglich war die Presseförderung so konstruiert, dass man die sogenannten „Zweitzeitungen“ gefördert hat. Also nie den Marktführer, sondern die Wettbewerber, um die Medienvielfalt zu erhöhen. Die ehemalige Medienministerin Susanne Raab von der ÖVP hat sich von dieser Idee verabschiedet. Stattdessen wurden lasche Journalismusförderungskriterien eingeführt, die dazu führten, dass auch Boulevardzeitungen Förderungen bekamen. Andreas Babler muss dieses Erbe nun übernehmen.
Vizekanzler Andreas Babler hat eine Erhöhung der Medienförderung um 55 Mio. Euro für 2026 angekündigt. Unter anderem sollen Zeitungsabos für junge Menschen subventioniert werden. Was erhofft er sich dadurch?
Trappel: Seine Idee ist, Geld in die Hand zu nehmen, damit Zeitungen zu einem jungen Publikum finden und im Wettbewerb bleiben. Seine Maßnahmen stabilisieren den Status quo. Die Medienförderung ist eigentliche eine Strukturerhaltungsförderung und Andreas Bablers Maßnahmen haben ebenfalls dieses Ziel.

Lässt das die Medienlandschaft nicht stagnieren?
Trappel: Innovation muss aus der Industrie kommen und nicht durch Subventionen. Das würde den Gesetzgeber überfordern, wenn er jetzt auch noch Innovator sein müsste. Unternehmen müssen sich selbst überlegen, wie sie ihre Produkte neu platzieren. Förderungen können dabei lediglich incentivieren und unterstützen.
Und wohin geht der Trend? Wie konsumieren Menschen heute Medien?
Trappel: Das Zeitungsleseverhalten hat sich bei den meisten Menschen wenig verändert in den letzten Jahrzehnten. Jedoch werden diese Leser älter, während die Jungen ein völlig anderes Leseverhalten haben. Es gibt überraschenderweise noch einen kleinen Anteil an Jugendlichen, die gerne auf Papier lesen, aber das ist nicht mehr die Masse. Grundsätzlich lesen Junge kürzere Abschnitte und zumeist auf dem kleinen Bildschirm, also auf dem Smartphone. Daher auch nicht mehr die langen Storys, die man aus der Zeitung kennt. Am Bildschirm liest man flüchtiger.
Das „OÖ Volksblatt“ wollte sich gänzlich zum digitalen Medium wandeln und ist daran gescheitert. Kann der Umstieg von Print auf online funktionieren?
Trappel: Die empirische Beobachtung ist, dass es noch nie funktioniert hat. Das erste Mal hat es Kurt Falk mit „täglich Alles“ im Jahr 2000 versucht. Dort hat es schon nicht geklappt. Ein aktuelles Beispiel einer Umstellung ist die „Wiener Zeitung“. Die hält sich allerdings nur durch die massiven Subventionierungen über Wasser. Hingegen gibt es ein paar internationale Beispiele, wo eine komplette Neugründung als Online-Medium funktioniert hat. In Österreich versucht es aktuell Florian Novak mit „Jetzt“. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Umstieg von Print auf online kenne ich jedoch nicht.
Innovation muss aus der Industrie kommen und nicht durch Subventionen.
Was sind die wirtschaftlichen Herausforderungen, mit denen klassische Medien aktuell kämpfen?
Trappel: Die Erlösströme der Medien werden von vielerlei Seiten angeknabbert. So richtig ins Geschäft hineingefressen haben sich aber vor allem digitale Plattformen, die großflächig Werbebudgets abräumen. Sie verkaufen Werbefläche gezielter, als das Massenmedien wie Tageszeitungen können. Auch Influencer bekommen heute ein Stück vom Kuchen ab, aber die fallen bedeutend geringer ins Gewicht als die großen Plattformen.
CHEFINFO feiert heuer 35-jähriges Jubiläum. Was müssen Medien tun, um in 35 Jahren noch relevant zu sein?
Trappel: Ich glaube, dass Journalismus auch 2060 noch eine Demokratieaufgabe zu erfüllen hat. Und zwar müssen sie eine Öffentlichkeit für Anliegen herstellen, die viele Menschen betreffen. Dies Kernaufgabe wird sich in 35 Jahren nicht verändern, die Formate aber vermutlich schon. Das Wesen des Journalismus wird jedoch auch in 35 Jahren noch Bestand haben.