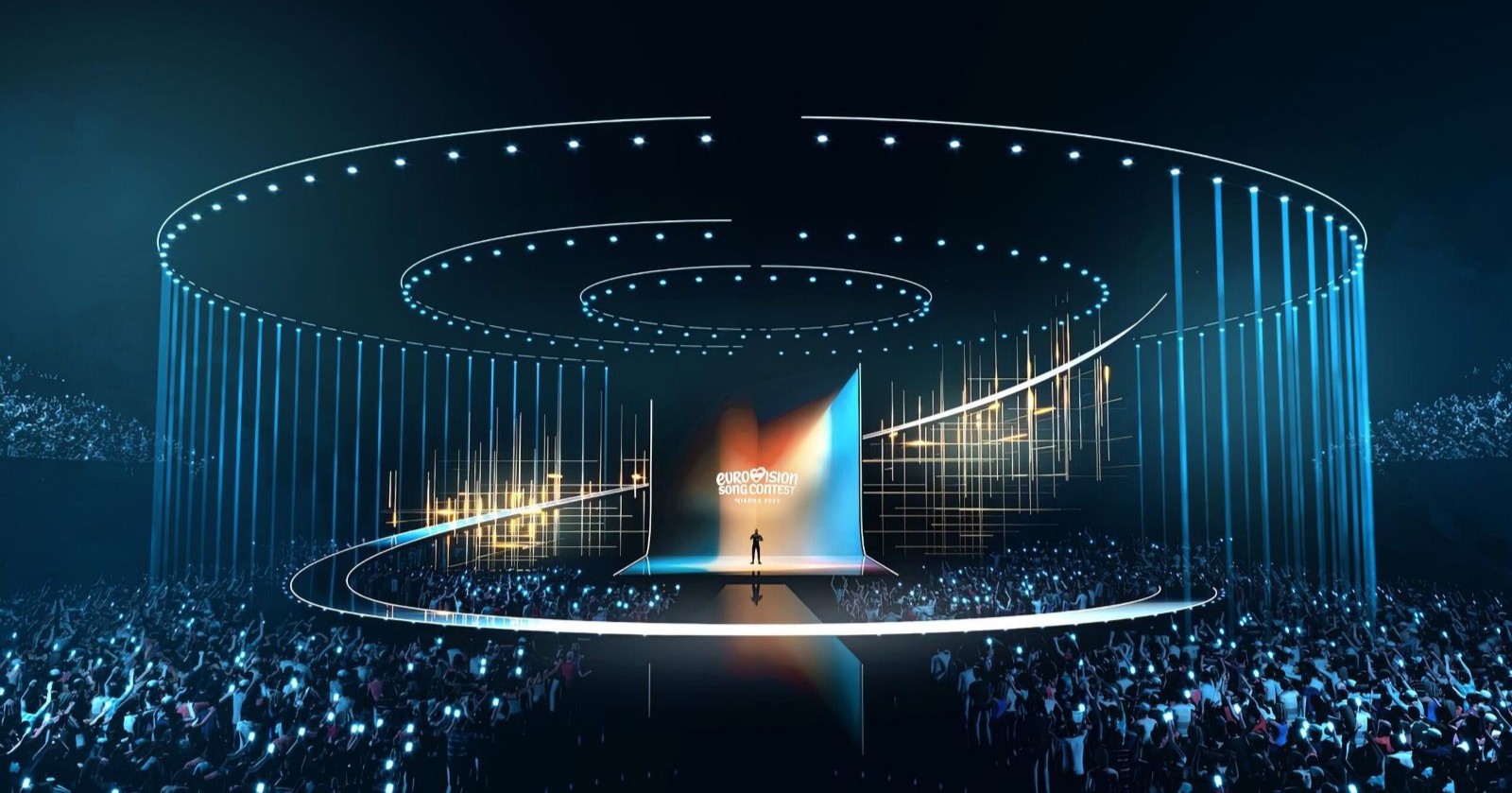IT:U - Universität im Kreuzfeuer
Das Leuchtturmprojekt Interdisciplinary Transformation University, kurz IT:U, wurde während der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz geplant und samt flankierenden Gesetzen parlamentarisch abgesegnet. Allein für den Bau wurden zunächst 250 Millionen Euro bereitgestellt, Bund und Land teilen sich im Rahmen einer sogenannten 15a-Vereinbarung die Entwicklungskosten. Sukzessive wurden Professorinnen und Professoren sowie begleitendes Lehrpersonal angeworben, derzeit liegt der Personalstand der neuen Hochschule bei 200 Personen. Die Anzahl der Studierenden nimmt sich mit derzeit etwa 120 (samt Doktoranden und Postdoktoranden) vergleichsweise läppisch aus. Mitgrund dafür: Die Standortfrage liegt auf Eis. Ursprünglich wollte man im Jahr 2030 in Linz-Auhof eröffnen – wie Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt prognostiziert, wird wohl erst frühestens in jenem Jahr zu bauen begonnen. Bis dahin ist die IT:U in zwei Behelfsquartieren eingemietet. Der Hintergrund: Das Grundstück für das VP-Prestigeprojekt, das mit der SP-regierten Stadt paktiert war, wurde wegen ökologischer Bedenken nicht zweckgewidmet, die Suche eines neuen zieht sich. Und mittendrin steht IT:U-Chefin Lindstaedt, renommierte Informatikerin und Wissenschaftsmanagerin mit ansehnlichem Industrie-Know-how, die den Auftrag hat, Österreichs modernste, dringend benötigte Hochschule hochzuziehen. Und dabei selbst „ins Kreuzfeuer“ geraten ist: das große Interview zum unendlichen Uni-Projekt
CHEFINFO: Die IT:U wurde als jüngste öffentliche Universität Österreichs gegründet, um digitale Transformation und KI voranzutreiben. Frau Lindstaedt, wie groß ist das tatsächliche Need in unserem wirtschaftlichen Alltag?
Stefanie Lindstaedt: Gemäß Digitalisierungsindex rangiert Österreich im unteren Drittel des Rankings. Das heißt, dass sowohl Firmen als auch Private nur sehr verhalten auf KI reagieren. Tatsächlich ist es aber so, dass gerade in den produzierenden Unternehmen der Einsatz von KI noch sehr, sehr gering ist und nur punktuell erfolgt. Und das betrifft nicht nur die KI im engeren Sinn, sondern eigentlich die meisten datengetriebenen Projekte. Wenn man sich die typische Fabrik vorstellt: Die ist darauf ausgerichtet, ein Produkt zu produzieren und nicht, die Daten zu managen, die damit zusammenhängen. Im ersten Schritt wurde das oft nicht mitgedacht – und nun hätte man diese Daten gerne. Doch es ist schwierig, sie aus all diesen Maschinen mit ihren unterschiedlichen Datenformaten und Informatik-Standards herauszufiltern und in einheitliche Data Layer zu überführen.
Der Wirtschaft ging es gut, der echte Wille, Transformation anzustoßen, war 20 Jahre nicht spürbar. Umso mehr beschwört man sie nun in den öffentlichen Reden.
KI-Fitness ist derzeit das Bildungspostulat schlechthin. Ist da also ein Gap zwischen den Ankündigungen und dem, was passiert?
Ich glaube, dieser starke KI-Push ist erst durch das Bewusstsein entstanden, wie abhängig wir in Sachen digitaler Technologie von nicht europäischen Playern sind. Das hat schon einen sehr großen Druck erzeugt. Ich habe das Know Center in Graz, ein Forschungszentrum für datengetriebene Wirtschaft, mit aufgebaut und war dort 20 Jahre lang tätig: 20 Jahre haben wir versucht, diese Technologien in den Unternehmen zu verankern. Damals nannte man das eben noch nicht KI, aber es waren stets datengetriebene Ansätze. Nur: Damals ging es der Wirtschaft noch so gut, dass man sich sagte: Das brauchen wir eigentlich nicht, machen wir eben hier und da ein kleines Projekt – aber dieser echte Wille, damit auch eine Transformation anzustoßen, war nicht zu spüren. Umso mehr beschwört man sie nun in den öffentlichen Reden.
Und wo stehen Sie mit der IT:U derzeit – personell und inhaltlich?
Wir haben etwa 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, etwa die Hälfte sind Frauen. Wir haben knapp 40 Masterstudierende und ebenso viele Doktoranden und Doktorandinnen, dazu noch 40 Postdoktorandinnen und -doktoranden. Wir haben jetzt 21 Professoren und Professorinnen – noch sind nicht alle bei uns, aber die letzten vier, fünf kommen in den nächsten Monaten. Und wir beschäftigen noch sogenannte Fellows, derzeit sechs, bald acht, die an anderen Universitäten eine Professur haben und zu etwa 20 Prozent bei uns sind: Wir sind ja eine Netzwerk-Universität. Wir haben in den vergangenen zweieinhalb Jahren zwei Doktoratsstudien aufgebaut, einmal „Computational X“, also Computerwissenschaft plus einer weiteren Disziplin. Und dann natürlich „Digital Transformation in Learning“, das wir gemeinsam mit der JKU entwickelt haben und wo wir neue Lernkonzepte und KIs entwickeln, die wir dann auch im Rahmen der Studienprogramme einsetzen.

Wie erklärt man dieses Verhältnis zwischen Personal und Studierenden dem Normalbürger?
Nun, um eine Universität aufzubauen, braucht man erst einmal Professoren. Wir haben bewusst mit den Doktorats-Programmen angefangen, weil das auch mit weniger Professoren funktioniert, anfangs hatten wir ja nur elf. Unser Masterprogramm wächst aber sukzessive an – bis Ende des kommenden Jahres wollen wir etwa 230 bis 250 Studierende haben.
250 Studierende bei 200 Mitarbeitern? Das wäre der Höhepunkt jeder populistischen Bierzeltrede.
Das stimmt wohl – das Verhältnis wird sich aber in den nächsten Jahren noch weiter verändern. Aber um das einmal ganz klar zu sagen: Wir sind froh, dass bei uns das Betreuungsverhältnis von Lehrpersonal zu Studierenden höher sein soll als an den anderen Unis. Wir leben in einer Zeit, in der unser Wissen exponentiell wächst – doch an den Unis haben wir nach wie vor ein lineares Lernmodell. Hier wird im Frontalunterricht gelehrt, und wir wissen, dass davon maximal fünf bis zehn Prozent hängen bleiben – und genau das können wir uns als Gesellschaft nicht mehr leisten. Deswegen denken wir ganz anders: Das Wertvollste ist die Zeit, in der Studierende und Professoren an Projekten zusammenarbeiten. Wenn ein Student bei uns sein Masterstudium beginnt, wird er einer Fünfergruppe, mit der er durchs Studium geht, zugeordnet. Dieses Team löst mit Unterstützung der Lehrenden eine Challenge, ein Projekt. Einerseits auf wissenschaftlicher Ebene dank der Expertise der Professoren, andererseits durch Unterstützung von Learn Coaches in Sachen Problemlösungsansätze, Konfliktmanagement und Critical Thinking. Auf ein Jahr kommen pro Studenten sechs solcher Projekte. Und im zweiten Jahr wird das dann noch vertieft, indem wir Problemstellungen aus der Industrie, der Wirtschaft, der Gesellschaft als Challenges bearbeiten.
An unseren Unis wird trotz exponentiell wachsendem Wissen im Frontalunterricht gelehrt: Das können wir uns als Gesellschaft nicht mehr leisten.
Ein Kulturschock! Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) hat, noch als Abgeordnete,
im Rahmen der Gründungsphase von „großer Skepsis in der wissenschaftlichen Community“ gesprochen und „Alarmglocken“ läuten gehört. Wie ist das erklärbar?
Wir sind eben die Ersten in Österreich, die dieses universitäre Lehrmodell einführen, das international schon eine längere Geschichte hat: Die Aalto University in Finnland macht das seit 50 Jahren, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich seit zehn – erst kürzlich waren wir zu Gast an der Harvard University und am Massachusetts Institute of Technology, da hat man uns voll bestärkt und ist neugierig auf unsere Erfahrungen. Vom Ministerium gab es ganz klar den Auftrag, anders zu sein, alles grundlegend neu zu denken. Einerseits kann das schon wie eine Art bewusster Gegenpositionierung wirken. Andererseits muss man auch sagen: Skepsis ist ein natürlicher Trieb in der Forschung und auch wichtig für den Fortschritt.
Ist die Grundskepsis eher psychologischer als inhaltlicher Natur?
Klar ist: Traditionelle Universitäten stehen durch die große Menge an Studierenden stark unter Druck, da ist ein projektbasiertes Lernmodell natürlich nur sehr, sehr schwer umzusetzen. Und deswegen hängt die Aussage in der Luft: „Das ist unfair, die einen bekommen Geld, um etwas Neues aufzubauen und wir nicht, obwohl wir so viele Studierende ausbilden.“ Deswegen ist unser Auftrag aber auch, diese Form der Lehre KI-gestützt so zu perfektionieren, dass eine Skalierungs-Möglichkeit vorliegt, von der auch andere Hochschulen profitieren. Denn Transformation macht vor den Unis nicht halt, ganz im Gegenteil. Wie will man im Zeitalter von KI argumentieren, dass sich 500 Leute in einen Vorlesungsraum zwängen und oft am Boden sitzen müssen? So kann man auf Dauer nicht weitermachen, und es muss neue Modelle geben.

Es geht also um Wohlstandsneid?
Das ist Ihre Formulierung, nicht meine. Aber dass jeder lieber mehr Geld für sich hätte, ist logisch und nachvollziehbar. Jede Rektorin, jeder Rektor hat den Auftrag, zuallererst die Bedürfnisse der eigenen Universität im Auge zu haben.
Wie kann es sein, dass sich Bund, Land und Stadt im Rahmen einer 15a-Vereinbarung zur Realisierung dieses Prestigeprojekts committen, und dann fehlt der Standort?
Nun, in der 15a-Vereinbarung steht ja der ursprüngliche Standort: ein Grundstück direkt neben der Johannes Kepler Universität – der dann aber von der Stadt leider doch nicht umgewidmet wurde.
Warum der Change of Mind?
Auch einen Change of Bürgermeister. Wobei Herr Prammer (SPÖ), zuvor als Stadtrat für Bau und Stadtplanung zuständig, voll eingebunden war. Aus welchen Gründen auch immer hat man sich dann aber gegen den Standort entschieden.
Ja, aus welchen Gründen?
Vielleicht waren es politische Gründe, wer weiß (lacht). Mit der grundsätzlichen Einstellung zur IT:U hatte es meiner Ansicht nach nichts zu tun – Prammer wurde nicht müde zu betonen, dass Linz der richtige Standort ist. Nun machen sich die fünf Player – Bund, Bundesimmobiliengesellschaft, Land, Stadt und wir – Gedanken über einen neuen Standort, das Gelände direkt neben dem Biodiversitätszentrum in Auhof steht im Raum.
Am Anfang war nicht der Standort der Stein des Anstoßes, sondern eher ich. Ich bin nun mal eine andere Person als die, die sich einige wünschten.
Als Sie Ihren Job angetreten haben, herrschte also noch eine andere Gemengelage.
Genau. Als ich angefangen habe, war ja eigentlich noch nicht der Standort der Stein des Anstoßes, sondern eher ich – ich denke, inhaltlich und fachlich hatte man an mir nichts auszusetzen, aber ich bin eben nun mal eine andere Person als jene, die sich ursprünglich einige wünschten. Das war zunächst das große Thema, die Standortdebatte ploppte dann erst später auf. Natürlich war das am Anfang nicht einfach, im Kreuzfeuer zu stehen. Aber ich habe trotzdem schnell bemerkt, dass es eine ganze Reihe von Playern gibt, die weiter an dieses Prestigeobjekt geglaubt haben. Und mit denen habe ich zu entwickeln begonnen.
(Zur Erklärung: In weiten Teilen der ÖVP galt Meinhard Lukas, Ex-Rektor der Johannes Kepler Universität, als „planmäßiger“ Kandidat, doch die Gremien gaben aus fachlicher Perspektive Lindstaedt den Vorzug.) Erst Kritik an Ihnen, dann die lähmende Standortfrage: Nur Zufall oder gibt es Zusammenhänge?
Bitte verstehen Sie, dass ich auf Spekulationen nicht eingehen kann. Wir lassen lieber die Fakten des erfolgreichen IT:U-Aufbaus für sich sprechen.
Auch eine Antwort. Wobei die Verzögerungen Steuergeld kosten und Ihnen den Job nicht leichter machen.
Es macht alles schwieriger, da haben Sie recht. Aber wir müssen das relativieren: Wenn wir den ursprünglichen Standort bekommen hätten, wäre das Gebäude 2030 gestanden. Das heißt, bis 2030 hätten wir so oder so eine Überbrückung gebraucht. Jetzt verzögert sich das wahrscheinlich alles so um etwa drei Jahre.
Wäre angesichts der Wirtschaftslage ein Schulterschluss nicht eine Frage der Moral, die über Befindlichkeiten zu stehen hätte?
Durchaus, denn im Speziellen in Oberösterreichs Industrie brauchen wir Leute, die ganz tief im Computing drinnen sind. Der andere Aspekt: Wir brauchen Personen, die diese Kompetenz mit anderen Disziplinen verknüpfen, also Chemie oder Maschinenbau oder Sozialwissenschaften oder was auch immer. Sie müssen teamfähig sein, sich auch selbst managen können. Menschen, die uns ohne langwierige Eingewöhnung weiterbringen: Plug and Play. Kurz und bündig: Wir brauchen IT:U-Absolventinnen und Absolventen.